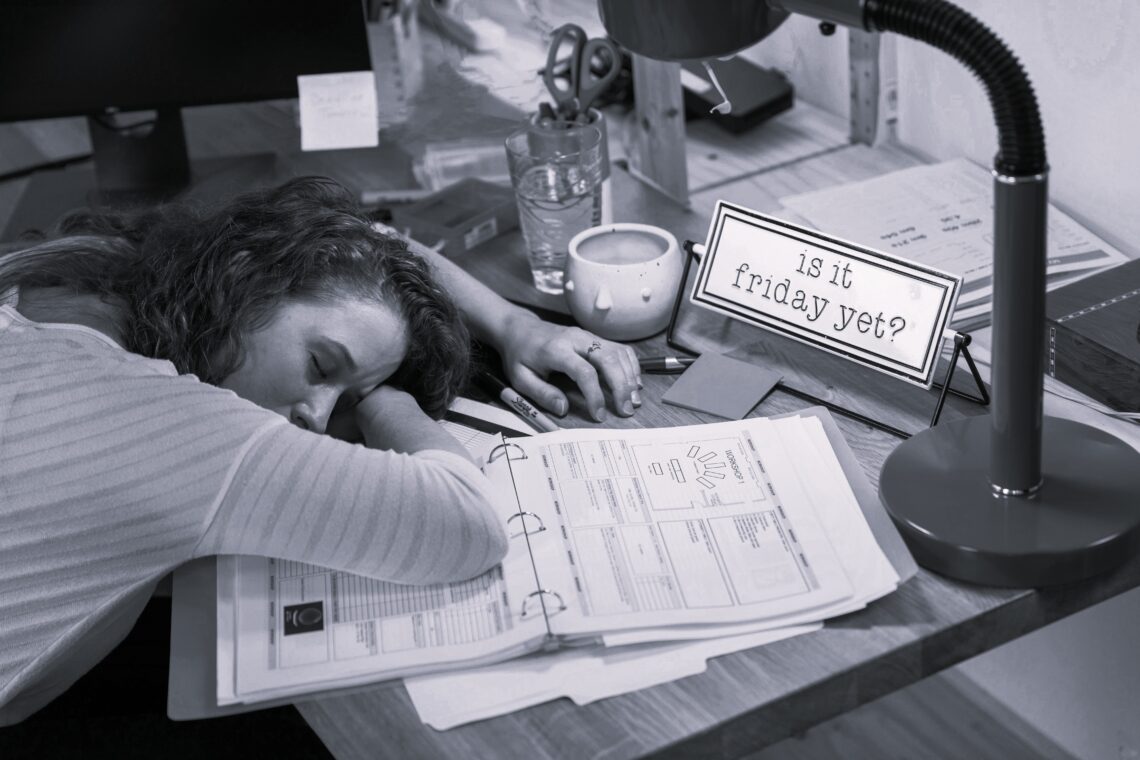
Ist Freiheit im Kapitalismus möglich?
Vor kurzem saß ich in einem Vorstellungsgespräch. Die Personalerin lächelte mich an und stellte die klassische Frage: Warum haben Sie sich bei uns beworben?
Meine ehrliche Antwort wäre gewesen: Weil ich Geld zum Überleben brauche.
Aber das habe ich nicht gesagt. Stattdessen verbrachte ich eine Stunde damit, zu erklären, wie spannend ich die ausgeschriebene Stelle finde, wie gerne ich meine Berufserfahrung hier einbringen würde, wie sehr ich mich auf die Herausforderungen freue und wie motiviert ich bin, mich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln.
Das war Maskierung pur: Eine Rolle spielen, unauthentisch sein, lügen und das alles, um eine Chance auf Einkommen zu haben. Ich dachte an all die Absagen, die vermutlich auch daran lagen, dass ich nicht genug geschmeichelt, nicht strahlend genug meine Motivation vorgetragen hatte. Und an die Male, in denen ich mich sogar im Nachgang noch für die Chance bedankt habe, ohne eine Rückmeldung zu erhalten.
Die Wahrheit ist: Die meisten würden wahrscheinlich ihre aktuelle Arbeit aufgeben, um andere Dinge tun zu können, oder ihre Stunden reduzieren, wenn sie finanziell abgesichert wären. Doch wir sind Teil einer Gesellschaft, in der Erwerbsarbeit eine Notwendigkeit zum Überleben darstellt und als eine moralische Pflicht inszeniert wird.
Psychische Belastungen durch Erwerbsarbeit
Erwerbsarbeit kann psychische Stabilität geben, wenn sie fair, sicher und sinnerfüllt ist. Unsichere, schlecht bezahlte und toxische Arbeitsbedingungen dagegen führen zu einem höheren Risiko für psychische Erkrankungen (z. B. Pulford et al., 2022).
Die DAK-Gesundheit berichtet im Psychreport 2024, dass sich die Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt haben. Besonders betroffen sind Menschen in sozialen Berufen, wobei Depression die häufigste Ursache für Krankschreibungen ist.
Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betont, dass unsichere Arbeitsverhältnisse, wie prekäre Beschäftigung, ein Risiko für die psychische Gesundheit darstellen. Sie nennt Jobunsicherheit, finanzielle Instabilität und Arbeitslosigkeit als Risikofaktoren für psychische Erkrankungen und suizidale Tendenzen.
Forschungsarbeiten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) haben zudem gezeigt, dass Menschen meist aus finanziellen Gründen in ihrem Job bleiben, obwohl sie unzufrieden sind. Job Lock ist ein bekanntes Phänomen: Menschen bleiben in einem ungeliebten Job, weil sie Angst vor Einkommensverlust, fehlender sozialer Absicherung oder Arbeitslosigkeit haben. Besonders betrifft dies Niedriglohnempfänger:innen, prekär Beschäftigte und Alleinerziehende. Das hat Folgen für die psychische Gesundheit und die Lebensqualität.
Die Illusion von Freiheit
Eines der hartnäckigsten Narrative des Kapitalismus lautet: Du bist frei. Du kannst dir aussuchen, was du machen willst. Auf den ersten Blick stimmt das, denn es gibt in unserer modernen Gesellschaft keine gesetzliche Pflicht zur Arbeit. Und es gibt Menschen, die ihren Beruf lieben. Menschen, die sich verwirklichen können. Menschen, die sich aussuchen dürfen, was und wie viel sie arbeiten möchten. Aber das ist nur eine kleine Minderheit. Die meisten von uns haben keine echte Wahl.
Die Freiheit ist eine Illusion. Ja, theoretisch können wir kündigen oder uns beruflich neu orientieren. Aber praktisch sind wir gebunden: Wer nicht arbeitet, hat kein Einkommen. Wer kein Einkommen hat, kann Miete, Lebensmittel, medizinische Versorgung und soziale Teilhabe nicht sichern.
Dabei entsteht eine subtile, aber permanente Erpressung: Arbeite zu den Bedingungen, die dir geboten werden oder verliere deine Existenzgrundlage.
Die ökonomische Realität zwingt uns zur Erwerbsarbeit, weil unser Überleben davon abhängt. Der freie Arbeitsmarkt ist nur für jene wirklich frei, die finanziell unabhängig sind.
Gaslighting in der Arbeitswelt
Bereits die Stellensuche zwingt uns, Rollen zu spielen. In Bewerbungsgesprächen geht es selten um Ehrlichkeit, sondern um Performance. Wir sollen begeistert wirken, Teamgeist versichern, uns als flexibel, belastbar, lernbereit inszenieren. Egal, wie müde, skeptisch oder desillusioniert wir in Wahrheit sind.
Wer hier nicht die richtigen Antworten gibt, scheidet aus. So müssen wir nicht nur unsere Arbeitskraft, sondern auch unser Auftreten und unsere Persönlichkeit dem Markt anpassen.
Hinzu kommt die Erwartung, dankbar zu sein. Wir sollen dankbar sein, auch für Jobs mit schlechten Arbeitsbedingungen, toxischem Betriebsklima und unzureichender Bezahlung. Wer sich beschwert, wird schnell als undankbar, schwierig oder illoyal abgestempelt.
Das ist Gaslighting: Man verkauft uns Abhängigkeit als Chance und Ausbeutung als Privileg.
Und weil dieses Narrativ tief in unsere Kultur eingebrannt ist, beginnen wir oft selbst zu glauben, wir müssten uns mehr anstrengen oder positiver denken, anstatt dieses System zu hinterfragen.
Konsum und Statusdenken
Der Kapitalismus lebt nicht nur von unserer Arbeitskraft, sondern auch von unserem Konsum. Er erzeugt Bedürfnisse, die oft gar keine sind und verknüpft unseren Wert als Mensch mit dem, was wir besitzen und darstellen.
Wer im kapitalistischen System erfolgreich wirken will, muss Zeichen dieses Erfolgs vorzeigen: Markenkleidung, ein bestimmtes Auto, Immobilien, oder exotische Urlaube.
Dieses Statusdenken hält uns in einer ständigen Spirale: Wir arbeiten, um Geld zu verdienen, das wir dann ausgeben, um unseren sozialen Wert zu sichern und um den Stress und die Erschöpfung aus der Arbeit selbst zu kompensieren.
Dieses System erzeugt die Illusion, wir hätten Kontrolle über unser Leben, während wir in Wahrheit nur dabeibleiben, um mithalten zu können. Der Druck, dazuzugehören sorgt dafür, dass viele Menschen in Jobs verharren, die sie unglücklich machen, weil sie fürchten, ohne das damit verbundene Einkommen ihren sozialen Status zu verlieren.
So wird der Zwang zur Erwerbsarbeit nicht nur durch Existenzsicherung aufrechterhalten, sondern auch durch die Angst vor Statusverlust und sozialer Ausgrenzung.
Gesellschaftliche Mitverantwortung
Wir alle tragen dazu bei, dass dieses System bestehen bleibt. Menschen, die nicht ins Arbeitsmodell passen, sei es aus gesundheitlichen Gründen, aus Überzeugung oder weil sie alternative Lebensformen wählen, werden stigmatisiert.
Wer keinen Job hat, gilt schnell als faul, unproduktiv und wertlos. Sanktionen im Sozialleistungssystem verschärfen diese Ausgrenzung. So disziplinieren wir uns gegenseitig und halten eine Wirtschaftsordnung aufrecht, die uns selbst schadet.
Wer profitiert davon?
Von diesem Zwangssystem profitieren vor allem jene, die im Besitz von Kapital sind: Unternehmen, Großaktionär:innen, Investor:innen. Sie können sicher sein, dass es immer genügend Arbeitskräfte geben wird, die bereit sind, ihre Zeit, Energie und Gesundheit zu verkaufen. Der Arbeitszwang sichert niedrige Löhne, weil die Angst vor Arbeitslosigkeit und Armut jede kollektive Verhandlungsmacht schwächt. Gleichzeitig stabilisiert er ein Konsummodell, das vor allem den oberen Einkommensschichten zugutekommt.
Auch Politiker:innen profitieren von der Aufrechterhaltung des Status quo. Sie sichern wirtschaftliche Stabilität, erhalten Unterstützung von Lobbygruppen und bewahren ein System, das soziale Kontrolle durch Erwerbszwang garantiert.
Hinzu kommen Akademiker:innen, gutverdienende Fachkräfte und Beamt:innen. Sie sind keine Hauptprofiteur:innen, aber systemische Mitgewinner:innen. Ihre vergleichsweise sicheren Positionen geben ihnen wenig Anreiz, das System grundsätzlich zu kritisieren.
Lösungen für mehr Freiheit
Eine grundlegende Veränderung erfordert politische und gesellschaftliche Maßnahmen, die den Erwerbszwang lockern.
- Bedingungsloses Grundeinkommen: Ein fester, existenzsichernder Betrag für alle würde den Zwang zur Erwerbsarbeit aufheben und echte Wahlfreiheit schaffen.
- Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich: Mehr Zeit für Selbstbestimmung, Familie, Bildung oder kreative Projekte und weniger gesundheitliche Belastungen.
- Demokratisierung von Unternehmen: Mitarbeiter:innen sollten Mitspracherecht bei Arbeitsbedingungen, Löhnen und Unternehmensentscheidungen haben.
- Aufwertung unbezahlter Arbeit: Care-Arbeit und ehrenamtliche Tätigkeiten sind gesellschaftlich wertvoll und müssen finanziell anerkannt werden.
- Förderung gemeinschaftlicher Wirtschaftsformen: Genossenschaften und solidarische Gemeinschaften zeigen, dass Wirtschaft auch ohne Zwang und Konkurrenz funktioniert.
Zusammenfassung
Der Zwang zur Erwerbsarbeit ist kein Naturgesetz, sondern ein Konstrukt, gemacht von Menschen, aufrechterhalten durch Gesetze, Werte und Machtinteressen. Er nimmt uns Freiheit, zwingt uns in unauthentische Rollen und schadet unserer Gesundheit.
Solange unser Überleben an die Bereitschaft gebunden ist, sich den Regeln des Kapitalismus zu unterwerfen, gibt es keine echte Freiheit. Die Illusion einer Wahl dient nur dazu, das System als legitim erscheinen zu lassen.
Echte Freiheit beginnt dort, wo wir Nein sagen können, ohne unsere Existenz zu verlieren.
Literatur
Pulford, A. (2022). Does persistent precarious employment affect health outcomes among working age adults? A systematic review and meta-analysis. J Epidemiol Community Health, 76, 909-917. doi: 10.1136/jech-2022-219292
https://www.dak.de/presse/bundesthemen/umfragen-studien/psychische-erkrankungen-in-der-arbeitswelt-2024-verursachten-depressionen-erneut-die-meisten-fehltage_131626?
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-at-work?

