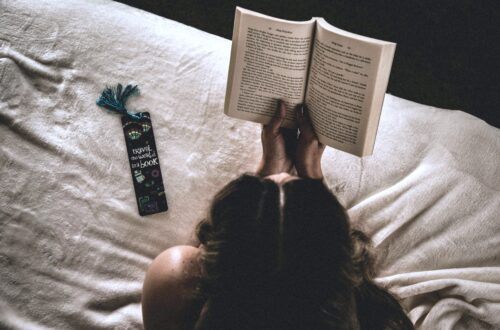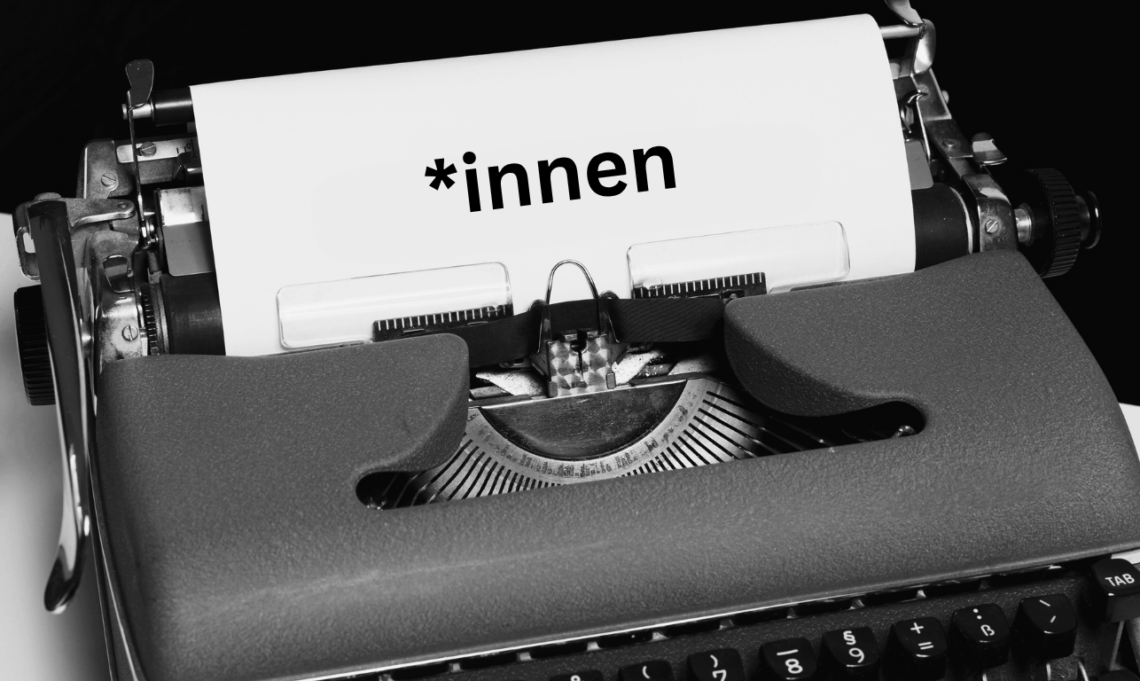
Sprache und Gleichberechtigung
Welches Bild hast du vor Augen, wenn du folgenden Satz liest:
Die Ärzte trafen sich zum Mittagessen in der Kantine.
Die Forschung zeigt, dass Menschen bei generisch-maskulinen Begriffen (z.B. Lehrer, Ärzte, Handwerker) meistens Männer visualisieren. Eine genderfaire Sprache (GFL, gender fair language), die geschlechtsneutrale Formulierungen oder beide Geschlechter benennt fördert sprachliche, wie auch gesellschaftliche Gleichberechtigung. Trotzdem empfinden viele diese Sprachformen als übertrieben oder als Einschränkung der Sprachfreiheit. Kritiker:innen argumentieren, Frauen und geschlechtsdiverse Personen sollen sich mitgemeint fühlen, denn das generische Maskulinum sei generisch.
Das generische Maskulinum ist nicht generisch
Psychologische Studien zeigen, dass das generische Maskulinum nicht neutral wahrgenommen wird. Bereits Stahlberg und Sczesny (2001) fanden heraus, dass bei Personenbezeichnungen im generischen Maskulinum der gedankliche Einbezug von Frauen signifikant geringer ausfiel als bei der Benennung beider Geschlechter oder einer geschlechtsneutralen Formulierung. Brohmer et al. (2024) bestätigten diesen Effekt in einer internationalen Laborstudie mit 2697 Teilnehmenden.
Auch neurowissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass das Gehirn mehr Verarbeitungsaufwand benötigt, wenn bei einer Personengruppe im generischen Maskulinum plötzlich von Frauen die Rede ist. Das Gehirn muss diese Unstimmigkeit korrigieren und verbraucht dafür mehr Kapazitäten, sowohl bei der visuellen, wie auch bei der sprachlichen Verarbeitung (Glim et al., 2023).
Rothermund und Strack (2024) prüften, ob es genügt, darauf hinzuweisen, dass mit dem generischen Maskulinum alle gemeint sind. Aber selbst wenn die Teilnehmenden mehrfach daran erinnert wurden, dass alle Geschlechter gemeint waren, blieb der male bias bestehen – das heißt eine kognitive Verzerrung zu Gunsten der männlichen Perspektive. Erst wenn kontextuelle Hinweise hinzukamen, wie „Die Nachrichtensprecher trugen schicke Anzüge und Kleider.“, verschwand die männliche Verzerrung.
Das Wissen um die generische Intention reicht also nicht aus. Bei der Nutzung des generischen Maskulinums entsteht eine automatische und unbewusste asymmetrische Geschlechterrepräsentation. Erst die eindeutige Benennung beider Geschlechter führt zu einer symmetrischen kognitiven Repräsentation.
Sprache formt das Selbstbild
Wenn Mädchen jahrelang nur von Ingenieuren, Forschern und Managern hören, beeinflusst das, was sie für sich selbst für möglich halten. Sprachliche Asymmetrien verhindern, dass Mädchen und Frauen sich in männlich konnotierten Rollen sehen.
Eine Studie mit Grundschulkindern belegte diesen Effekt. Wenn traditionell männliche Berufe in genderfairer Sprache dargestellt wurden (Ingenieurinnen und Ingenieure), trauten sich die Mädchen mehr zu und zeigten ein größeres Interesse an diesen Berufen (Vervecken, Hannover & Wolter, 2013). Die Sprache beeinflusst also direkt, wie Kinder ihre Fähigkeiten einschätzen und welche Berufe sie für sich in Betracht ziehen.
Bei erwachsenen Frauen reduziert die Verwendung des generischen Maskulinums das Zugehörigkeitsgefühl, die Identifikation und die Motivation für eine Position im beruflichen Kontext (Stout & Dasgupta, 2011).
Die Forschung zeigt außerdem, dass Menschen, die genderfaire Sprache unterstützen, dies oft bewusst tun, um Werte der Gleichberechtigung zu kommunizieren. Die Ablehnung genderfairer Sprachformen hängt dagegen häufig mit sexistischen Einstellungen zusammen. So verwenden Personen mit modernen sexistischen Überzeugungen eher geschlechterungerechte Sprache und sind weniger sensibel für sexistische Formulierungen (Swim, Mallett & Stangor, 2004).
Eine Studie von Sarrasin, Gabriel und Gygax (2012) bestätigte über drei Sprachen hinweg (englisch, französisch, deutsch), dass sowohl moderner, wohlwollender als auch feindseliger Sexismus mit negativen Einstellungen zu genderfairer Sprache korreliert.
Sprachgebrauch ist also nicht neutral. Sprache transportiert Werte und Überzeugungen.
Genderfaire Sprache fördert Gleichberechtigung
Wie dargestellt, hat genderfaire Sprache eine Wirkung. In einem Review fassten Sczesny, Formanowicz und Moser (2016) den Forschungsstand zusammen und genderfaire Sprache kann Geschlechterstereotype und Diskriminierung reduzieren.
Hier eine Übersicht zu den wichtigsten Forschungsergebnissen:
- Wenn beide Geschlechter explizit benannt werden, reduziert das den male bias und es findet eine ausgeglichene mentale Repräsentation der Geschlechter statt.
- Diese Wirkung zeigt sich bereits im Grundschulalter. Genderfaire Sprache führt bei Mädchen zu einer höheren kognitiven Repräsentation von Frauen in stereotyp männlichen Berufen und auch die berufliche Selbstwirksamkeit der Mädchen in stereotyp männlichen Berufen steigt (Lenhart & Heckel, 2025).
- Frauen fühlen sich durch genderfaire Sprache in Stellenausschreibungen stärker angesprochen und bewerben sich häufiger, als wenn nur die männliche Berufsbezeichnung genannt wird. Die Wortwahl beeinflusst also die wahrgenommene Passung zur Stelle (Fatfouta und Sczesny, 2023).
- Die Verwendung genderfairer Sprache reduzierte stereotype Denkmuster und fördert positive Einstellung gegenüber Frauen und LGBT-Personen (Tavits und Pérez, 2019).
- Genderfaire Sprache verzerrt die Einschätzung der eigenen Selbstwirksamkeit bei Frauen. Diese wird als höher eingeschätzt, wenn genderfaire Sprache verwendet wird (Vainapel et al., 2015).
- Aus sozialpsychologischer Perspektive lässt sich die Wirkung von Sprache auf die Selbstwirksamkeit mit Banduras Konzept erklären (Bandura, 1977). Selbstwirksamkeit beschreibt die Überzeugung, aufgrund eigener Fähigkeiten bestimmte Aufgaben erfolgreich bewältigen zu können. Sprache spielt dabei eine zentrale Rolle, weil sie soziale Realität strukturiert und beeinflusst, welche Möglichkeiten Menschen für sich selbst als erreichbar wahrnehmen.
Wenn Personen in sprachlichen Beschreibungen sichtbar sind, stärkt das ihre Wahrnehmung, gemeint und handlungsfähig zu sein. Wer sich in Rollenbildern wiederfindet, z.B. durch genderfaire Berufsbezeichnungen, entwickelt eher das Vertrauen, diese Rolle auch selbst ausfüllen zu können.
Fehlt diese sprachliche Repräsentation, entsteht der gegenteilige Effekt. Menschen schließen unbewusst aus, dass bestimmte Tätigkeiten oder Positionen für sie selbst infrage kommen.
Sprache wirkt damit nicht nur auf Gedanken und Einstellungen, sondern auch auf die Motivation und das Verhalten. Sie beeinflusst, welche Ziele sich Menschen setzen und wie sie mit Herausforderungen umgehen. Genderfaire Sprache kann so dazu beitragen, Selbstwirksamkeitserwartungen über Geschlechtergrenzen hinweg zu stärken und stereotype Rollenbilder zu verändern.
Kritik an genderfairer Sprache
Ein Kritikpunkt lautet, genderfaire Sprache mache Texte schwer lesbar, sei unverständlich und schränke die Sprachfreiheit ein.
Studien zeigen jedoch, dass manche Menschen genderfaire Formulierungen anfänglich als ungewohnt empfinden. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit gibt es keine signifikanten Unterschiede in der Lesegeschwindigkeit oder dem Textverständnis (Friedrich & Heise, 20219; Pabst & Kollmayer, 2023).
Die Anpassungsfähigkeit des menschlichen Gehirn sorgt dafür, dass auch genderfaire Sprache problemlos zur Gewohnheit werden kann, genauso wie andere sprachliche Veränderungen auch.
Die Befürchtung, dass Menschen sich aus Trotz gegen sprachliche Gleichberechtigung sperren, findet ebenfalls keine Unterstützung. Im Gegenteil die Akzeptanz wächst, wenn die Gründe für genderfaire Sprache nachvollziehbar dargestellt werden (Tavits & Pérez, 2019).
Eine Übersichtsarbeit von Borchers (2022) fasst den Forschungsstand zusammen und zeigt, dass die Kritikpunkte auf Fehlannahmen beruhen und empirisch nicht haltbar sind.
Sprache als Teil eines größeren Wandels
Sprache signalisiert, wer gesehen wird, wer gemeint ist und wer Handlungsmacht hat.
Genderfaire Sprache ist Teil eines gesellschaftlichen Wandels. Sie steht in einer Reihe mit gleicher Bezahlung, fairer Verteilung von Care-Arbeit und der Bekämpfung von Diskriminierung in allen Lebensbereichen. Sprache macht Ungleichheiten sichtbar und kann Einstellungen verändern.
Ein genderfaires Sprachsystem führt nicht automatisch zu mehr Gleichberechtigung. In Ländern mit grammatikalisch neutralen Sprachen, wie Türkisch oder Ungarisch, besteht weiterhin Geschlechterungleichheit. Sprache ist also kein alleiniger, aber ein wichtiger Faktor. Sie schafft Bewusstsein und verändert stereotype Denkmuster.
Genderfaire Sprache ist ein Werkzeug, um Gleichberechtigung zu fördern. Es geht nicht darum, Menschen vorzuschreiben, wie sie sprechen sollen. Es geht darum, bewusste Entscheidungen zu treffen: Wollen wir eine Sprache, die alle Menschen gleichermaßen repräsentiert? Wollen wir, dass Mädchen sich genauso angesprochen und gemeint fühlen, wie Jungen es bei der maskulinen Form tun?
Wir haben die Wahl und die Forschung zeigt, dass diese Wahl einen Unterschied macht.
Zum Weiterlesen
Sprache und Sein von Kübra Gümüşay
Literatur
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215. doi:10.1037/0033-295X.84.2.191
Borchers, M. (2022). Geschlechterfaire Sprache: "Gendergaga" oder geboten?. InFo Hämatol Onkol 24, 63-67. doi:10.1007/s15004-021-8704-9
Brohmer, H., et al. (2024). Effects of the generic masculine and its alternatives in germanophone countries: A multi-lab replication and extension of Stahlberg, Sczesny, and Braun (2001). International Review of Social Psychology, 37(1). doi:10.5334/irsp.522
Fatfouta, R., & Sczesny, S. (2023). Unconscious bias in job titles: Implicit associations between four different linguistic forms with women and men. Sex Roles: A Journal of Research, 89(11-12), 774-785. doi:10.1007/s11199-023-01411-8
Friedrich, M. C. G., & Heise, E. (2019). Does the use of gender-fair language influence the comprehensibility of texts? An experiment using an authentic contract manipulating single role nouns and pronouns. Swiss Journal of Psychology, 78(1-2), 51-60. doi:10.1024/1421-0185/a000223
Glim, S., Körner, A., Härtl, H., & Rummer, R. (2023). Early ERP indices of gender-biased processing elicited by generic masculine role nouns and the feminine-masculine pair form. Brain and Language, 242, 105290. doi: 10.1016/j.bandl.2023.105290
Glim, S., Körner, A., & Rummer, R. (2023). Generic masculine role nouns interfere with the neural processing of female referents: Evidence from the P600. PsyArXiv. doi:10.31234/osf.io/6bkxd
Lenhart, J., & Heckel, F. (2025). Effects of gender-fair language on the cognitive representation of women in stereotypically masculine occupations and occupational self-efficacy among primary school girls and boys. Sex Roles, 91(6). doi:10.1007/s11199-024-01552-4
Pabst, A., & Kollmayer, M. (2023). Reading gender-fair language: No long-term comprehension costs. Frontiers in Psychology. doi:10.3389/fpsyg.2023.1234860
Rothermund, P., & Strack, F. (2024). Reminding may not be enough: Overcoming the male dominance of the generic masculine. Journal of Language and Social Psychology, 43(4), 468-485. doi:10.1177/0261927X241237739
Sarrasin, O., Gabriel, U., & Gygax, P. (2012). Sexism and attitudes toward gender-neutral language: The case of english, french, and german. Swiss Journal of Psychology, 71(3), 113–124. doi:10.1024/1421-0185/a000078
Sczesny, S., Formanowicz, M., & Moser, F. (2016). Can gender-fair language reduce gender stereotyping and discrimination? Frontiers in Psychology, 7, 25. doi:10.3389/fpsyg.2016.00025
Stahlberg, D., & Sczesny, S. (2001). Effekte des generischen Maskulinums und alternativer Sprachformen auf den gedanklichen Einbezug von Frauen. Psychologische Rundschau, 52(3), 131–140. doi:10.1026/0033-3042.52.3.131
Stout, J. G., & Dasgupta, N. (2011). When he doesn’t mean you: Gender-exclusive language as ostracism. Personality and Social Psychology Bulletin, 37(6), 757-769. doi:10.1177/0146167211406434
Swim, J. K., Mallett, R., & Stangor, C. (2004). Understanding subtle sexism: Detection and use of sexist language. Sex roles: A Journal of Research, 51(3-4), 117–128. doi:10.1023/B:SERS.0000037757.73192.06
Tavits, M., & Pérez, E. O. (2019). Language influences mass opinion toward gender and LGBT equality. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(34), 16781-16786. doi:10.1073/pnas.1908156116
Vainapel, S., Shamir, O. Y., Tenenbaum, Y., & Gilam, G. (2015). The dark side of gendered language: The masculine-generic form as a cause for self-report bias. Psychological Assessment, 27(4), 1513–1519. doi:10.1037/pas0000156
Vervecken, D., Hannover, B., & Wolter, I. (2013). Changing (s)expectations: How gender fair job descriptions impact children's perceptions and interest regarding traditionally male occupations. Journal of Vocational Behavior, 82(3), 208-220. doi:10.1016/j.jvb.2013.01.008

Das könnte dich ebenfalls interessieren

Wie die Idealisierung der Liebe uns einsam macht
14. August 2025