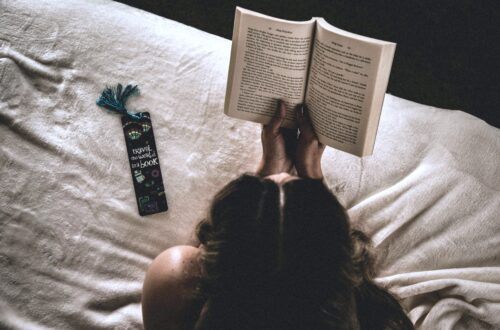Wie die Idealisierung der Liebe uns einsam macht
Die romantische Paarbeziehung gilt als Inbegriff menschlichen Glücks – vom ersten Kuss, über das Gründen einer Familie, bis zum gemeinsamen Altwerden. Die romantische Liebe dominiert unsere Vorstellung von Erfüllung und Intimität. Sie ist Inhalt zahlloser Filme, Bücher und Songs. Sie gilt als Ziel und Bestimmung eines erfüllten Lebens. Aber hält die romantische Liebe überhaupt, was sie verspricht? Oder macht diese Idealisierung uns einsam?
In diesem Beitrag werfen wir einen kritischen Blick auf die romantische Paarbeziehung als Teil von patriarchalen und kapitalistischen Strukturen. Wir beleuchten, warum sie vor allem Frauen strukturell benachteiligt, Männer emotional begrenzt und welche Rolle alternative Beziehungskonzepte in einer wirklich verbundenen Gesellschaft spielen könnten.
Die Hierarchie von Beziehungen
In unserer Gesellschaft herrscht eine unausgesprochene, aber tief verankerte Hierarchie von Beziehungen. An oberster Stelle steht die romantische Liebe, im normativen Idealfall in Form einer hetero-monogamen Ehe mit dem Ziel eine Familie zu gründen. Die Ehe genießt kulturelle, soziale und rechtliche Bevorzugung: Steuervorteile, medizinische Vertretungsvollmachten, gesellschaftliche Anerkennung.
Freundschaften hingegen, obwohl sie oft länger halten, emotional stabiler sind und einen bedeutenden Beitrag zu unserem Wohlbefinden leisten, fristen ein Leben im Schatten. Es gibt keine Verträge, keine öffentlichen Zeremonien oder Jahrestagsfeier, die sie würdigen.
Diese Hierarchisierung führt dazu, dass Menschen sich gezwungen fühlen, eine Person zu ihrem Lebensmittelpunkt zu machen. Nicht, weil es emotional stimmig ist, sondern weil es die gesellschaftliche Erwartung ist. So werden enge Freundschaften geopfert, sobald die Paarbeziehung beginnt. Zeit, Energie und emotionale Arbeit fließen exklusiv in die romantische Partnerschaft. Und was bleibt, wenn sie endet? Entwurzelung, Einsamkeit.
Die Vereinzelung im Zeitalter der Paarnorm
Wenn alle Zeit und Energie in die romantische Paarbeziehung fließt, was passiert dann mit dem sozialen Umfeld?
Viele Menschen erleben es: Freundschaften werden vernachlässigt, sobald jemand eine Paarbeziehung beginnt. Gemeinsame Wochenenden weichen Paarritualen. Plötzlich gilt nur noch wir zwei – exklusiv und abgeschlossen. Freund:innen, mit denen vorher enger Kontakt bestand, verschwinden in der romantischen Paarbeziehung. Noch stärker passiert dies, wenn Frauen Mütter werden und sie vollkommen in die Kleinfamilie abtauchen.
Was dabei übersehen wird: Die meisten Paarbeziehungen enden. Trennungen sind Teil der Realität. Danach stehen viele Menschen alleine da, ohne tragfähige Netzwerke, ohne Freund:innen, denen man noch wirklich nahe ist. Die Priorisierung der Paarbeziehung hat ihre sozialen Wurzeln gekappt.
Diese strukturelle Vereinsamung betrifft nicht nur Menschen ohne Partnerschaft. Auch in bestehenden Beziehungen fühlen sich viele Menschen einsam, weil sie glauben, all ihre Bedürfnisse müssen in dieser einen Beziehung erfüllt werden. Aber kein Mensch kann alle emotionalen Funktionen für einen anderen erfüllen. Das ist eine Überforderung, die in Isolation führt, auch zu zweit.
Paarbeziehung und Kleinfamilie als System der Ungleichheit
Die Vorstellung von der romantischen Paarbeziehung, möglichst mit Heirat, ist kein natürliches Phänomen, sondern ein soziales Konstrukt. Und dieses Konstrukt dient konkreten Interessen: patriarchalen, staatlichen und ökonomischen.
Sozialisation und geschlechtsspezifische Erwartungen
Nach wie vor dominiert die Vorstellung, dass Partnerschaft und Familie das Lebensziel von Frauen sein sollte. Von klein auf, werden weiblich gelesene Personen dahin sozialisiert, sich selbst über Beziehungen zu definieren: Über ihre Beliebtheit, Attraktivität und emotionale Fürsorge. Schon Mädchen wird vermittelt: Du bist wertvoll, wenn du gemocht wirst. Wenn du begehrt wirst. Wenn du die Richtige bist. Eine Partnerschaft ist keine Option für Frauen, sondern die Voraussetzung für soziale Anerkennung und Kinder sind ein Beweis für den Erfolg einer Partnerschaft.
Männer dagegen werden nicht für ihren Beziehungsstatus bewertet. Ein kinderloser Singlemann ist vielleicht karriereorientiert, freiheitsliebend und sogar bewundernswert. Eine Frau ohne Partnerschaft und Kinder gilt als ungewöhnlich, egoistisch und gescheitert. Der männliche Lebensentwurf darf unabhängig sein und sich über Karriere und Hobbys definieren, der weibliche wird über Beziehungen definiert.
Ungleiches Geben und Nehmen
Für Frauen war und ist die Zweierbeziehung und Kleinfamilie ein Tauschgeschäft: emotionale und körperliche Verfügbarkeit gegen soziale Absicherung. Auch wenn heute viele Frauen ökonomisch unabhängiger sind, wirken diese Muster weiter. Frauen übernehmen in Beziehungen nach wie vor den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit und tragen auch mental, sowie emotional die größere Last. Sie pflegen, organisieren, regulieren Emotionen, tragen die Verantwortung für das Gelingen der Beziehung und bezahlen dafür mit Karriereeinbußen, Überforderung und Altersarmut (z.B. Barigozzi et al., 2025; Lott & Bünger, 2023).
Gleichzeitig wird Frauen erzählt, dass genau dieses Leben sie erfüllen soll, dass es ihr Lebensziel ist, eine gute Partnerin und Mutter zu sein. Und damit führt die Idealisierung der romantischen Paarbeziehung und Kleinfamilie dazu, dass Frauen sich freiwillig ausbeuten lassen und den Männern aus Liebe den Rücken freihalten. Und wenn sie unglücklich sind? Dann haben sie den falschen Partner gewählt, oder sich nicht genug angestrengt.
Heterosexuelle Männer dagegen profitieren von der Paarbeziehung. Sie erhalten emotionale Unterstützung, sexuelle Verfügbarkeit, soziale Stabilität und oft sogar kostenlose Haushaltsführung – ohne sich in gleichem Maß zu revanchieren.
Die Forschung zeigt, dass verheiratete Männer länger leben und gesünder sind, weil sie durch ihre Partnerinnen besser versorgt werden. Für Frauen ist dieser Effekt nicht in gleicher Weise vorhanden (Ho et al., 2024). Insbesondere Mütter haben sogar ein erhöhtes Risiko für psychische und körperliche Krankheiten gegenüber unverheirateten, kinderlosen Frauen (Bode, 2023).
Staatliche Interessen und Liebe als Konsumtreiber
Auch der Staat profitiert von der Ehe. Wer verheiratet ist bekommt mehr Rechte und muss weniger vom Sozialsystem unterstützt werden, da gegenseitige Versorgung erwartet wird. Die Vorstellung, dass jede Beziehung privat ist und damit auch jedes Problem, führt dazu dass die zunehmende Vereinzelung und Einsamkeit individualisiert, statt kollektiv gelöst wird. So wird der private Raum zum Rückzugsort staatlicher Verantwortung.
Kapitalistische Gesellschaften stützen sich auf die Kleinfamilie als Grundeinheit der Produktion und Reproduktion. Die unbezahlte Care-Arbeit der Frauen ist die Grundvoraussetzung für die Erwerbsarbeit der Männer im Kapitalismus.
Und schließlich profitiert die Wirtschaft. Paarbeziehungen schaffen neue Konsumfelder, wie Hochzeiten, Pärchenurlaube, Partnergeschenke und Eigenheime für die Kleinfamilie. Die romantische Liebe ist ein Milliardenmarkt.
Das Patriarchat schadet auch den Männern – nur anders
Während Frauen systematisch überbewertet werden (Idealisierung der Mutterrolle) und gleichzeitig abgewertet werden, erfahren Männer ebenfalls Schaden durch patriarchale Beziehungsstrukturen, indem ihre emotionalen Kompetenzen verarmen.
In einer heteronormativen Gesellschaft wird Männlichkeit über die Abgrenzung vom Weiblichen definiert. Eigenschaften, die vor allem Frauen zugeschrieben werden, wie Empathie, Fürsorge, Verletzlichkeit oder auch Kooperation gelten als schwach und unmännlich – sie werden abgewertet und verdrängt. Schon als Kinder, lernen Männer: Nähe ist Schwäche, Verletzlichkeit ist unangebracht, Sanftheit ist peinlich und Kommunikation ist Drama. Stattdessen gilt Leistung, Abgrenzung und Dominanz.
Gleichzeitig besteht jedoch gesellschaftlich die Erwartung, dass Männer heterosexuelle Beziehungen mit Frauen eingehen. Dadurch entsteht eine widersprüchliche Situation: Männer sollen intime Partnerschaften mit Menschen führen, die als Trägerinnen genau jener Eigenschaften gelten, die sie gelernt haben abzulehnen.
Diese Ambivalenz erschwert Beziehungen auf Augenhöhe erheblich. Denn wer das Weibliche, in sich selbst oder in anderen, ablehnt, kann kaum einen respektvollen und gleichwertigen Umgang mit einer Partnerin entwickeln. Das führt in Beziehungen zu mangelndem Respekt, Dominanzverhalten und Unverständnis gegenüber den Bedürfnissen der Partnerin. Im schlimmsten Fall begünstigt dieser Frauenhass Femizide.
Hinzu kommt, dass die Ablehnung von weiblichen Eigenschaften zu einem Mangel an Selbstreflexion und emotionaler Kompetenz führt. Damit fehlen Männern oft die Fähigkeiten, die für eine gleichberechtigte, emotionale Partnerschaft nötig sind. Das führt nicht selten dazu, dass Frauen mehr emotionale Verantwortung übernehmen und Männer sich emotional entziehen.
Solange das Weibliche abgewertet wird, bleibt die Partnerschaft strukturell ungleich. Gleichberechtigung beginnt also nicht im gesellschaftlichen Raum, sondern in der Paarbeziehung.
Sexualität als Schlüssel zur Exklusivität
Ein wesentlicher Grund, warum romantische Paarbeziehungen so hoch bewertet werden, liegt in ihrer Exklusivität in Bezug auf Sexualität. Die romantische Zweierbeziehung wird meistens als einziger legitimer Raum für sexuelle Begegnung und körperliche Intimität betrachtet. Diese Überbewertung der Sexualität führt dazu, dass andere Beziehungen, wie Freundschaften und familiäre Bindungen von körperlicher Nähe entkoppelt werden.
In heteronormativen Gesellschaften wird von Männern erwartet, dass sie körperlich distanziert zu anderen Männern bleiben, emotional kontrolliert auftreten und körperliche Nähe nur in sexuell-romantischen Beziehungen suchen dürfen.
Freundschaft? Bitte ohne Kuscheln. Körperkontakt zwischen Männern? Bloß nicht. Selbst Mütter und Väter beginnen, Berührungen mit ihren Kindern zu hinterfragen, sobald diese zu alt sind.
Dabei ist Berührung ein menschliches Grundbedürfnis. Noch bevor wir sprechen lernen, erfahren wir die Welt durch Berührung. Die erste Sprache des Lebens ist körperliche Nähe. Sie reguliert unser Nervensystem, stärkt unser Immunsystem, reduziert Angst und fördert Vertrauen. Doch im Erwachsenenleben wird körperliche Nähe oft auf eine einzige Beziehung konzentriert: die romantisch-sexuelle Paarbeziehung.
Wenn körperliche und emotionale Intimität für Männer ausschließlich in romantisch-sexuellen Beziehungen erlaubt ist, kann das dazu führen, dass andere Formen von Nähe sexualisiert werden, das Bedürfnis nach Berührung mit sexuellem Verlangen verwechselt oder ersetzt wird und Sexualität als einziger legitimer Kanal für Nähe erlebt wird.
Diese Einschränkungen können dazu führen, dass Männer emotional unterversorgt sind, sich einsam fühlen, aber diese Gefühle nicht einordnen oder ausdrücken können und in Sexualität eine Ersatzbefriedigung suchen – nicht nur für Lust, sondern für Nähe, Geborgenheit und Anerkennung. Ein überhöhter Sexualtrieb kann so zu einem Symptom sozialer Isolation werden.
Frauen stellen in Freundschaften Nähe durch Kommunikation her, indem sie sich austauschen, über sich reden, Interesse zeigen und zuhören. Männer dagegen definieren Freundschaften oft über gemeinsame Aktivitäten, wie Sport, Ausflüge, Spiele oder Projekte. Das ist an sich nicht problematisch, aber es reduziert emotionale Verbindung auf Funktion. Und so ist die romantische Beziehung oft der einzige Ort, an dem emotionale Intimität für Männer erlaubt ist.
Auch die Forschung bestätigt, dass heterosexuelle Männer stärker auf romantische Partnerschaften angewiesen sind, um emotionale Bedürfnisse zu erfüllen. Was unter anderem daran liegt, dass Männer in Freundschaften seltener emotionale Unterstützung suchen und erhalten (Wahring, Simpson & Van Lange, 2024).
Studien zeigen zudem, dass Frauen ohne Partnerschaft zufriedener sind und über eine Trennung schneller hinwegkommen, als Männer. Männer trennen sich zudem seltener, im Vergleich zu Frauen, und wünschen sich häufiger eine Partnerin (Ochnik & Slonim, 2020; Wahring et al., 2025). Auch hier ist der Grund, dass Männer stärker auf die emotionale Unterstützung durch eine Partnerschaft angewiesen sind. Frauen hingegen haben oft auch außerhalb einer Partnerschaft enge Vertrauenspersonen.
Die radikale Kraft der Freundschaft
Wir brauchen eine Aufwertung all jener Beziehungsformen, die jenseits der romantischen Paarbeziehung existieren.
Freundschaft ist nicht weniger intim, nicht weniger tief als eine Paarbeziehung. Sie kann Nähe, Loyalität, emotionale Intimität und sogar Alltag teilen. In Freundschaften wird emotionale Arbeit geteilt, Bedürfnisse werden verhandelt, statt erwartet. Freundschaft ist ein Ort, an dem Menschen füreinander da sein können, ohne dass Eigentum, Exklusivität oder gesellschaftlicher Status eine Rolle spielen. Sie ist ein Modell für gleichwertige solidarische Beziehungen.
In einer Welt, die uns ständig dazu auffordert, den richtigen Menschen zu finden, ist es ein radikaler Akt, ein Leben zu gestalten, das aus einem Netzwerk besteht, aus vielen verschiedenen, gleichwertigen Beziehungen.
Eine neue Beziehungsordnung
Eine gerechtere und weniger einsame Gesellschaft braucht eine andere Vorstellung von Nähe und Verbindung und ein Umdenken in der Beziehungsordnung. Weg von der Paarnorm und hin zu einer pluralen Beziehungskultur.
Was wäre, wenn wir die Liebe neu denken würden? Wenn wir:
- Beziehungen als Netzwerk, statt Zentrum begreifen
- Freundschaften institutionell aufwerten (z. B. durch Sorgegemeinschaften)
- Körperliche Berührung entsexualisieren
- Emotionale Kompetenz bei allen Geschlechtern fördern
- Die Kleinfamilie nicht als Ideal, sondern als eine Möglichkeit unter vielen betrachten
Das wäre nicht nur gerechter, sondern auch eine Antwort auf eine zunehmende gesellschaftliche Vereinsamung.
Fazit
Die romantische Paarbeziehung (mit Kleinfamilie) ist nicht per se falsch. Aber sie ist überhöht und überbewertet und trägt massiv zur sozialen, emotionalen und körperlichen Isolation bei. Sie erfüllt Funktionen, die oft nicht zum Wohle der Liebenden sind. Frauen verlieren ihre Autonomie, Männer ihre emotionale Tiefe. Freundschaften verkümmern und Nähe wird monopolisiert.
Es wird Zeit, das zu ändern. Nicht, indem wir gegen die Liebe sind, sondern indem wir für mehr Liebe sind. Für mehr Formen, mehr Räume, mehr Vielfalt. Für ein Leben, in dem Beziehungen gewählt, nicht erwartet werden und in dem Intimität kein exklusives Gut ist. Für eine Liebe, die den Raum öffnet für alles Sein, denn wir können nicht losgelöst existieren. Alles was wir tun, wirkt über uns selbst hinaus.
Vielleicht liegt das Glück nicht in der großen Liebe, sondern in vielen tiefen Verbindungen, zu Menschen, zu Tieren, zur Natur und zu unserem (Mensch)Sein.
Zum Weiterlesen:
Das Ende der Ehe von Emilia Roig
Entromantisiert euch! Ein Weckruf von Beatrice Frasl
Literatur:
Barigozzi, F. et al. (2025). Beyond time: unveiling the invisible burden of mental load. arXiv.org. doi: 10.48550/arXiv.2505.11426
Bode, A. et al. (2023). Die Gesundheit von Müttern im Fokus der Vereinbarkeit von Beruf und Familie – ein Scoping-Review. GMS Z Hebammenwiss, 10. doi: 10.3205/zhwi000025
Ho, M., Pullenayegum, E., Burnes, D., & Fuller-Thomson, E. (2024). The association between trajectories of marital status and successful aging varies by sex: Findings from the Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA). International Social Work, 68(1), 88-111. doi: 10.1177/00208728241267791
Lott, Y., & Bünger, P. (2023). Mental Load – Frauen tragen die überwiegende Last. WSI Report, 87. https://www.wsi.de/de/faust-detail.htm?produkt=HBS-008679
Ochnik, D., & Slonim, G. (2020). Satisfaction with singlehood in never-married singles: The role of gender and culture . Open Psychol J, 13. doi: 10.2174/1874350102013010017
Wahring, I. V., Simpson, J. A., & Van Lange, P. A. M. (2024). Romantic relationships matter more to men than to women. Behavioral and Brain Sciences. Published online. doi: 10.1017/S0140525X24001365
Wahring, I. V., et al. (2025). Men and women transitioning to singlehood in young adulthood and midlife. Psychol Aging, 40(2), 117-136. doi: 10.1037/pag0000859


Das könnte dich ebenfalls interessieren